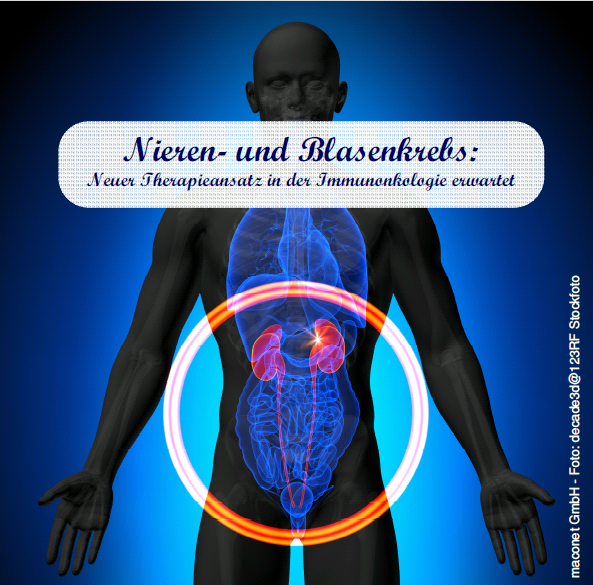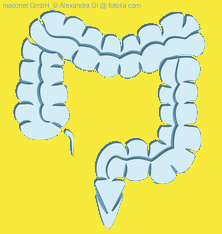Archiv für die Kategorie „Krebserkrankungen“
Nieren- und Blasenkrebs: Neuer Therapieansatz in der Immunonkologie erwartet
Eine Tumorerkrankung mit dem eigenen Immunsystem angreifen? Genau dieser Mechanismus wird durch verschiedene neue Substanzen aus dem Bereich der „Immunonkologie“ verfolgt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Therapieansätzen, wie der Chemotherapie, bei denen der Tumor direktes Ziel des Wirkstoffes ist, funktionieren die Immunonkologika über eine verstärkte Immunantwort und die daraus resultierende anti-tumoröse Wirkung der körpereigenen Abwehr.
„Dieser Mechanismus greift auch bei urologischen Tumoren und wird die Therapievielfalt beim metastasierten Nierenzellkarzinom und beim metastasierten Harnblasenkarzinom in Kürze erweitern“, sagt Prof. Dr. Christian Wülfing, Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU) angesichts der bevorstehenden Zulassung neuer Wirkstoffe in der uroonkologischen Immuntherapie. Jährlich erkranken laut Statistik des Robert Koch-Instituts in Deutschland rund 15 000 Männer und Frauen neu an Nierenkrebs und etwa 29 000 an Blasenkrebs.
 Prof. Dr. Christian Wülfing, Urologie, Asklepios Klinik Altona
Prof. Dr. Christian Wülfing, Urologie, Asklepios Klinik Altona
Schlüssel für den Fortschritt im Kampf gegen Krebs sind die „T-Zellen“. Prof. Wülfing: „Die körpereigenen zytotoxischen T-Zellen, die in der Lage sind, körperfremde Zellen – auch Tumorzellen – zu erkennen und zu zerstören, werden durch ein komplexes Zusammenspiel bestimmter aktivierender und hemmender Signale gesteuert. Diese sogenannten Immun-Checkpoints steuern die Zerstörung von fremden Zellen, verhindern dabei aber eine dauerhafte Immunantwort und somit eine Schädigung gesunden Gewebes. Die wichtigsten Regulatoren in diesem Zusammenspiel sind die PD-1-/PD-L1- und die CTLA-4 Signalwege, die in den letzten Jahren in den Fokus der pharmakologisch-onkologischen Forschung kamen.“ Verschiedene neue Wirkstoffe, die diese Signalwege anzielen, konnten synthetisiert und in klinische Studien eingebracht werden.
Zwei dieser neuen Substanzen zeigen in aktuellen Studien ein deutlich verlängertes Überleben für Patienten mit metastasiertem Nierenzellkarzinom (mNZK) und für Patienten mit metastasiertem Harnblasenkarzinom. Der Wirkstoff Nivolumab wurde in einer randomisierten Phase-III Studie zur Zweitlinientherapie des mNZK (Nivolumab versus Everolimus in Advanced Renal-Cell Carcinoma, Robert J. Motzer et al.) getestet. Insgesamt 821 Patienten wurden in den Nivolumab- oder Everolimus-Therapiearm randomisiert. Es fand sich ein Gesamtüberleben von 25,0 versus 19,6 Monaten, was einer 23%igen Verringerung des Sterberisikos entsprach.
Beim metastasierten Harnblasenkarzinom wurde die Substanz Atezolizumab in einer Phase-II Studie getestet, die zuletzt im Januar 2016 in San Francisco vorgestellt wurde (IMvigor 210, a phase II trial of atezolizumab (MPDL3280A) in platinum-treated locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (mUC)). Hier konnten 310 Patienten eingeschlossen und im Sinne einer Zweitlinientherapie nach Cisplatin-Therapieversagen behandelt werden. Abhängig von der PD-L1-Expression im Tumorgewebe konnte ein objektives Ansprechen in bis zu 26% und ein Überleben von bis zu 11.4 Monaten erzielt werden.
„Erfreulicherweise gingen die Behandlungen mit diesen innovativen Substanzen insgesamt mit einem sehr günstigen Toxizitätsprofil einher“, sagt der DGU-Pressesprecher. So scheinen die Wirkstoffe nur sehr selten höhergradige Nebenwirkungen auszulösen. Selten scheint auch mit immunvermittelten Nebenwirkungen wie Durchfall und Bauchkrämpfen oder Störungen der Hormonproduktion und -regulation zu rechnen zu sein, deren Behandlung, laut Prof. Wülfing, geschult erfolgen müsse.
Während Atezolizumab zunächst in einem klinischen Studienprogramm weiter verfolgt und derzeit in einer Phase-III Studie zur unterstützenden Therapie nach Entfernung der Harnblase (adjuvante Therapie) getestet wird, ist der klinische Einsatz von Nivolumab zur Immuntherapie beim metastasierten Nierenzellkarzinom in Deutschland in Kürze zu erwarten. Prof. Wülfing: „Nachdem die amerikanische Zulassungsbehörde FDA aufgrund der dargestellten Studienergebnisse Nivolumab Ende 2015 die Marktfreigabe für die Indikation fortgeschrittenes Nierenzellkarzinom erteilt hat, ist in den nächsten Monaten mit der europäischen Zulassung zu rechnen.“ Ein wichtiger Schritt dahin ist getan: Aktuell hat der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) die Indikationserweiterung empfohlen. Die Empfehlung wird nun von der Europäischen Kommission, die über die Zulassung von Arzneimitteln in den Mitgliedsstaaten entscheidet, geprüft. Nivolumab ist bereits bei metastasiertem Lungen- und Hautkrebs zugelassen.
„Im nächsten Schritt geht es um die Frage nach der besten Therapiesequenz in der Uroonkologie, das heißt der individuell optimalen Anwendung des neuen Wirkstoffs“, sagt DGU- und Kongresspräsident Prof. Dr. Kurt Miller und verweist auf den 68. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. vom 28. September bis 1. Oktober 2016 in Leipzig, wo die Immuntherapie des mNZK zu den vielversprechendsten wissenschaftlichen Themen zählt.
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU e.V.)
Darmkrebs-Therapie: Vermeidung von Resistenzen
Krebszellen teilen sich häufig und machen dabei auch noch besonders viele Fehler. Mit fatalen Folgen: Tumore wachsen, breiten sich im Körper aus und können Resistenzen gegen Therapeutika ausbilden. Wissenschaftler aus Göttingen wollen nun mit Unterstützung der Deutschen Krebshilfe Strategien entwickeln, um dies beim Darmkrebs gezielt zu vermeiden.
Unser Erbgut liegt in jeder Körperzelle doppelt vor. Teilt sich eine Zelle, dann wird es gleichmäßig auf die beiden entstehenden Tochterzellen übertragen. Doch bei der Zellteilung können Fehler auftreten. Bei Krebszellen kommen diese Fehler besonders häufig vor. So werden etwa die beiden Chromosomensätze, die Erbgutträger, oft nicht gleichmäßig auf die Tochterzellen verteilt und die neue Generation an Zellen bringt zahlreiche Varianten hervor, die sich in ihrer genetischen Ausstattung voneinander unterscheiden. Dadurch können auch Varianten entstehen, die sich der Behandlung entziehen. Die Folge: Der Tumor kann lebensbedrohliche Resistenzen gegen Therapeutika entwickeln.
Warum gerade bei Krebszellen die Teilung so fehlerbehaftet ist, darüber ist noch nicht viel bekannt. Wissenschaftler der Universitätsmedizin Göttingen wollen dies nun beim Darmkrebs genauer untersuchen. „Erst wenn die zugrunde liegenden Mechanismen bekannt sind, die bei der Krebstherapie zu gefährlichen Resistenzen führen, können diese gezielt unterdrückt werden. Für die Entwicklung optimierter und zuverlässiger Behandlungsstrategien bei Darmkrebs erhoffen wir uns hiervon sehr viel“, erklärt Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe.
Der Projektleiter, Professor Dr. Holger Bastians vom Institut für Molekulare Onkologie der Universitätsmedizin Göttingen und vom Göttinger Zentrum für Molekulare Biowissenschaften, und sein Team haben in Vorarbeiten vor kurzem einen Mechanismus identifiziert, der eine zentrale Rolle bei der hohen Anpassungsfähigkeit von Darmkrebszellen spielt: das Mikrotubulisystem. Dies ist ein Gerüst innerhalb der Zellen, das analog zu einem Schienennetz den Weg für die Chromosomensätze bei der Zellteilung vorgibt. „Das System ist in Zellen normalerweise hoch dynamisch und sehr gut reguliert, da es häufig umstrukturiert werden muss. In Darmkrebszellen jedoch läuft die Dynamik der Mikrotubuli aus dem Ruder. Sie sind auffallend flexibler als gesunde Zellen, was die Fehlverteilung der Chromosomen auf die Tochterzellen bedingt“, erklärt Bastians.
Der Wissenschaftler und sein Team wollen dies im Rahmen des von der Deutschen Krebshilfe geförderten Projektes nun genauer untersuchen. Ihr Ziel ist es, die ungleiche Verteilung der Chromosomen bei der Zellteilung gezielt zu unterdrücken. „Wenn wir es schaffen, die hohe Anpassungsfähigkeit von Darmkrebszellen einzudämmen, können wir Therapieresistenzen besser verhindern und Metastasierungen möglicherweise begrenzen“, beschreibt Bastians das Ziel des Projektes.
Hintergrundinformation: Darmkrebstherapie
Darmkrebs (Kolonkarzinom) ist die dritthäufigste Krebserkrankung in Deutschland. 33.400 Männer und 27.600 Frauen erkranken jedes Jahr neu daran (Robert Koch Institut 2015). Damit betrifft rund jede achte Krebserkrankung in Deutschland den Darm. Darmkrebs umfasst Krebserkrankungen des Dickdarms (Kolon), des Enddarms (Mastdarm/Rektum) und des Darmausgangs (Anus).
In den meisten Fällen wird der Tumor operiert. Bei manchen Patienten wird der chirurgische Eingriff mit einer Chemotherapie kombiniert. Auch die Kombination von Chemo- und Immuntherapie wird mittlerweile zur Darmkrebsbehandlung angewendet.
Quelle: Stiftung Deutsche Krebshilfe
DKK 2016 – Krankheitsbewältigung: Neue Patientenleitlinie zur Psychoonkologie
Der Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e.V. (BPS) weist auf eine neue Behandlungsleitlinie zur Psychoonkologie hin, die von der Stiftung Deutsche Krebshilfe und medizinischen Fachgesellschaften gemeinsam mit Patientenvertretern entwickelt wurde.
Download der Patientenleitlinie
Im Rahmen des laufenden 32. Deutschen Krebskongresses in Berlin ist die neue Patienten-Leitlinie „Psychoonkologie – Psychosoziale Unterstützung für Krebspatienten und Angehörige“ erschienen. Die Empfehlung beruht auf der bereits bestehenden Handlungsempfehlung der ärztlichen S3-Leitlinie “Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatienten” des Leitlinienprogramms Onkologie und damit auf dem besten derzeit verfügbaren medizinischen Wissen. „In dem Zusammenhang wünschen wir uns sehr, dass die Ärzte die neue Empfehlung umsetzen“, so Joachim Böckmann, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe e.V. (BPS) und Vorsitzender des BPS-Arbeitskreises „Psychoonkologie“ am Freitag in Berlin.
Die Diagnose Krebs verändert das Leben von Patienten und deren Angehörigen. Oftmals sind nicht körperliche sondern seelische und soziale Belastungen die Folge. Hier setzt die Psychoonkologie an, sie hilft Patienten, mit den vielfältigen Veränderungen besser umgehen zu können.
Eine weitere Besonderheit? Die Patientenbroschüre ist in einer laienverständlichen Sprache geschrieben. „Dies ist äußerst wichtig für Patienten und Angehörige. Fachbegriffe sind bei Medizinern an der Tagesordnung, führen aber oft zur Verunsicherung bei Patienten. Dies ist nun vorüber“, so Böckmann weiter. Die neue Patienten-Leitlinie wurde von der Stiftung Deutsche Krebshilfe (DKH), der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) und von den Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) finanziert und gemeinsam mit Patientenvertretern in den vergangenen zwei Jahren entwickelt. Der BPS war an der Erarbeitung intensiv beteiligt. „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Gerade viele Männer tun sich mit ihrer Psyche recht schwer! Diese Leitlinie hilft, Ängste und bekannte Zurückhaltung der Männer ein wenig zu überwinden“, so BPS-Vertreter und Mitglied der Arbeitsgruppe Berthold Isele. Ursula Reitberger vom BPS-Arbeitskreis „Frauen“ kommentierte vergangenes Jahr die Konsultationsfassung, sie wünscht sich: „Die Bedeutung der Psychoonkologie sollte an Wert gewinnen, sowohl in der Öffentlichkeit, als auch innerhalb der Ärzteschaft. Es wäre schön, wenn die neue Patientenversion dazu beitragen könnte.“
Quelle: Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e.V. – BPS
DKK 2016: Der informierte Patient – Individuell beraten, gemeinsam entscheiden

Broschüre als download beim Bundesgesundheitsministerium: “Nationaler Krebsplan” :
Um Betroffene in Deutschland bestmöglich zu unterstützen, hat die Deutsche Krebshilfe ihren telefonischen Beratungsdienst modernisiert. Seit Oktober 2014 können Ratsuchende die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des INFONETZ KREBS kontaktieren. Die kostenfreie Beratung beruht dabei auf einer Datenbank nach aktuellem Stand der Medizin und Wissenschaft, die in Zusammenarbeit mit der Deutschen Krebsgesellschaft entwickelt wurde. „Im vergangenen Jahr haben die Beraterinnen und Berater des INFONETZ KREBS insgesamt rund 10.000 Gespräche geführt und schriftliche Anfragen beantwortet. Eine Zahl, die uns den großen Informationsbedarf nochmal eindrucksvoll bestätigt und uns außerdem zeigt, welch großes Vertrauen Betroffene in Deutschland dem INFONETZ KREBS entgegenbringen“, so Nettekoven.
Für viele Betroffene ist das Internet häufig das erste Recherchemittel. Es hält jedoch eine wahre Flut an Informationen bereit, und nur schwer lässt sich zwischen seriösen und interessengesteuerten Aussagen unterscheiden. „Schon auf der ersten Seite der Suchmaschine tauchen außerdem alle Reiz- und Schreckenswörter auf“, beschreibt Andrea Hahne, Vorstandsvorsitzende vom BRCA-Netzwerk – Hilfe bei Familiärem Brust- und Eierstockkrebs, die Situation aus der Sicht einer Betroffenen. Als kompetente Ansprechpartner nennt sie in diesem Zusammenhang auch die Krebsselbsthilfe-Organisationen, die bei der Beratung auf eigene Erfahrungen zurückgreifen und damit authentisch berichten können.
Für die behandelnden Ärzte auf der anderen Seite besteht eine besondere Herausforderung darin, statistische Zusammenhänge zu erfassen und ihren Patienten zu vermitteln. Aussagen wie „Die relative Überlebensrate liegt bei 57 %“ oder „Die Rezidivwahrscheinlichkeit beträgt 12 %“ können Patienten nur schwer einordnen. Selbst für Ärzte sind statistische Angaben mitunter schwer abzuwägen. „Mangelndes Verständnis für Statistik kann aber leicht zu falschen Entscheidungen führen“, erklärte Professor Dr. Gerd Gigerenzer, Direktor des Harding Zentrums für Risikokompetenz und des Forschungsbereichs Adaptives Verhalten und Kognition am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Eine fundierte statistische Ausbildung von Medizinstudenten und bereits praktizierenden Ärzten sei daher dringend erforderlich.
Zu wenig Zeit für den einzelnen Patienten auf Seiten der Ärzte und der Pflege, häufig wechselnde Behandler und mangelnde Teamkommunikation behindern aktuell den Prozess des gemeinsamen Entscheidens. Dies stellte Dr. Isabelle Scholl vom Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf in einer Studie fest. „Nur selten werden Therapieentscheidungen heute gemeinsam von Arzt und Patient getroffen“, erklärte Scholl. Um dieses Problem anzugehen, hat sie ein Programm entwickelt, das helfen soll, die gemeinsame Entscheidungsfindung in den medizinischen Alltag zu integrieren.
Krebs ist eine Erkrankung, die überwiegend im höheren Alter auftritt. Ältere Patienten haben oft eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen und Funktionseinschränkungen, die eine entsprechende Unterstützung notwendig machen. „Die ohnehin schwierige Aufklärung eines Patienten über Diagnose und Therapieoptionen bei einer Krebserkrankung wird oft zusätzlich durch kognitive Einschränkungen des Patienten und die Notwendigkeit der Aufklärung von Angehörigen erschwert“, erklärte Prof. Dr. Elisabeth Steinhagen-Thiessen, Geriaterin an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. „Wir brauchen eine vertrauensvolle fächerübergreifende Zusammenarbeit der Onkologie, Palliativmedizin und Geriatrie, um die Herausforderungen bei älteren onkologischen Patienten zu meistern und optimal behandeln zu können.“
Quelle: Deutscher Krebskongress 2016 – Veranstalter: Stiftung Deutsche Krebshilfe / Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
DKK 2016: Krebsprävention: Vernachlässigter Bereich unseres Gesundheitswesens?
Krebsprävention und Krebsfrüherkennung sind die wichtigste Basis für ein Leben ohne Krebs. Angesichts steigender Neuerkrankungszahlen müsse in Deutschland jedoch deutlich mehr als bislang in diesen Bereichen getan werden, so das Experten-Fazit auf einer Pressekonferenz anlässlich des Deutschen Krebskongresses 2016. Auf der Veranstaltung wurden aktuelle Erkenntnisse aus der Präventionsforschung vorgestellt und Maßnahmen aus dem Bereich der Primärprävention, der Früherkennung und der Prähabilitation diskutiert.
„Wir haben mittlerweile Belege dafür, dass eine nachhaltige Änderung des Lebensstils tatsächlich etwas bringt. Wer zum Beispiel mit dem Rauchen aufhört oder bei einem Body-Mass-Index von mehr als 30 sein Gewicht reduziert, der kann auch tatsächlich sein Krebsrisiko senken“, erklärte Prof. Dr. Olaf Ortmann, Mitglied des Vorstands der Deutschen Krebsgesellschaft auf der Veranstaltung. Jetzt gehe es vor allem darum, die entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen zu formulieren, sowohl für die Aufklärung der Bevölkerung als auch zur Risikovermeidung. „Leider wissen wir zu wenig darüber, wie wir große Bevölkerungsgruppen nachhaltig zur Vermeidung von Risiken motivieren und dabei unterstützen können. Hier ist deutlich mehr wissenschaftliche Forschung notwendig“, so Ortmann.
Für strukturierte und qualitätskontrollierte Konzepte zur risikoadaptierten Prävention bei erblich bedingten Krebserkrankungen plädierte Prof. Dr. Rita Schmutzler, Direktorin des Zentrums Familiärer Brust- und Eierstockkrebs in Köln. Schätzungsweise bei einem Drittel aller Brust-, Darm- und Prostatakrebserkrankungen sind genetische Risikofaktoren im Spiel. Bis vor kurzem waren nur einige Hochrisikogene wie BRCA1 und BRCA2 bekannt, die jedoch nur einen Teil dieser erblich bedingten Fälle erklären. Mit den neuen technischen Möglichkeiten der genomweiten Analyse werden gegenwärtig eine Reihe weiterer Risikogene identifiziert, die in Zukunft eine präzisere und individuelle Risikoberechnung ermöglichen werden. Dies betrifft nicht nur das Erkrankungsrisiko, sondern auch Informationen über den spezifischen Tumorsubtyp. Prinzipiell kann dadurch die Effektivität von Früherkennungsprogrammen, wie z. B. das Mammographiescreening deutlich verbessert werden. Doch bei welchem Risiko oder Tumorsubtyp sind welche klinischen Maßnahmen nötig? Für welche Patientin kommt wann welche Früherkennung infrage? Schmutzler: „Angesichts dieser komplexen Fragen brauchen wir eine qualitätsgesicherte Gendiagnostik, die den Bogen vom Labor bis in die Klinik spannt und sich auf aussagekräftige Studien stützt. Die Grundvoraussetzung dafür sind neu zu errichtende Register zu familiären Tumorerkrankungen, um die Effektivität unserer Präventionsmaßnahmen bei erblichen Krebserkrankungen zu erfassen und kontinuierlich zu messen.“
Wie wichtig es ist, Früherkennungsmaßnahmen durch Forschung zu begleiten, zeigen die Studien von Prof. Dr. Hermann Brenner vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Brenner, der Preisträger des Darmkrebs-Präventionspreises 2015, untersucht die Wirksamkeit der Darmkrebsfrüherkennung seit mehr als zehn Jahren. Durch seine Untersuchungen konnte er z. B. zeigen, dass bis zu 90 Prozent der Darmkrebsfälle durch eine Vorsorge-Koloskopie verhütet werden könnten und das Darmkrebsrisiko nach einer Vorsorgekoloskopie ohne auffälligen Befund über mehr als zehn Jahre sehr niedrig ist. Dieses Ergebnis unterstützt die derzeitige Praxis eines Zehn-Jahres-Intervalls bei der Vorsorge-Koloskopie. Trotz dieser Bestätigung ist die Akzeptanz für die Vorsorge-Koloskopie in der Bevölkerung nach wie vor niedrig. Deshalb gehe es vor allem darum, organisierte Einladungsverfahren zu implementieren, in denen die berechtigten Versicherungsnehmer individuell angesprochen und über die verfügbaren Screeningverfahren aufgeklärt werden. „Außerdem müssen neue Methoden evaluiert werden, die die Akzeptanz des Screenings in der Bevölkerung erhöhen“, so Brenner.
Anders als beim Darmkrebs gibt es beim Lungenkrebs bislang noch kein geeignetes Screeningverfahren. Einer amerikanischen Studie zufolge kann zwar eine jährliche Mehrschicht-Computertomographie (MSCT) die Lungenkrebs-Sterblichkeit bei starken Rauchern um 20 Prozent senken. Doch die Rate falsch positiver Ergebnisse ist hoch, d. h. manche Teilnehmer müssen wieder einbestellt werden, um verdächtige Befunde zu überprüfen, die sich dann gar nicht als Lungenkrebs herausstellen. Die Ergebnisse der LUSI-Studie, einer randomisierten kontrollierten Studie mit mehr als 4.000 Teilnehmern, zeigen, dass der falsche Alarm ab der zweiten Screening-Runde unter bestimmten Bedingungen abnehmen kann. „Verdächtige Befunde im ersten CT, die sich in der darauffolgenden Untersuchung nicht verändert haben, sind offensichtlich keine Krebsherde. Eine erneute Abklärung ist deshalb nicht mehr notwendig“, erklärt LUSI-Studienleiter Prof. Dr. Nikolaus Becker vom DKFZ Heidelberg. Allerdings gehen die „falschen Alarme“ nur zurück, wenn die Vorbefunde früherer Screeningrunden für diese Beurteilung vorliegen, ein Lungenkrebs-Screening also als „organisiertes Screening“ durchgeführt würde. Die Endauswertung von LUSI und anderen europäischen Studien zur Lungenkrebsfrüherkennung ist für die nächsten ein bis zwei Jahre geplant.
Vorbeugen hilft möglicherweise auch dann noch, wenn der Krebs schon diagnostiziert ist, so PD Dr. Freerk Baumann von der Sporthochschule Köln. Dieses junge Forschungsfeld wird unter dem Begriff Prähabilitation zusammengefasst und steht für das Verbinden von Prävention und Rehabilitation. Das Konzept: Eine rechtzeitige bewegungstherapeutische Intervention unmittelbar nach der Krebsdiagnose soll die Patienten körperlich auf die Therapiephase vorbereiten. Nach dem Motto „Fit für die Krebsbehandlung“ wollen die Wissenschaftler so möglichen Komplikationen und Nebenwirkungen vorbeugen. „Erste Daten zeigen, dass die Prähabilitation nicht nur die Nebenwirkungen der Krebsmedikamente verhindert, sondern auch die Therapiedosierung während der Behandlung beibehalten werden kann. Außerdem lassen sich Krankenhaustage reduzieren“, betonte Baumann.
Quelle: Deutscher Krebskongress DKK 2016
Moderne Krebsmedizin: präventiv, personalisiert, präzise und partizipativ
Die Chancen moderner Krebsmedizin: innovative Therapien für den individuellen Patienten
Anhand der Forschungsergebnisse der Wissenschaftler um Professor Dr. Matthias Fischer von der Universitätskinderklinik zu Köln wird deutlich, wie wichtig die genaue molekulare Charakterisierung von Tumoren für die Entwicklung verbesserter Therapien ist. Der Mediziner untersucht genetische Veränderungen im Neuroblastom, das zu den häufigsten Tumorarten im Kindesalter gehört. In manchen Fällen bildet sich das Neuroblastom ohne jegliche Therapie komplett zurück, bei anderen Patienten jedoch schreitet es trotz Therapie unaufhaltsam voran. Die Gründe dafür waren bisher weitgehend unbekannt. Die Kölner Wissenschaftler konnten nun die genetischen Veränderungen, die zu einem aggressiven Krankheitsverlauf führen, identifizieren. „Unsere Erkenntnisse verändern unser Verständnis der Entwicklung des Neuroblastoms fundamental und könnten in Zukunft Diagnostik und Therapie des Neuroblastoms maßgeblich beeinflussen“, so Professor Fischer.
Dr. Fritz Pleitgen, Präsident der Deutschen Krebshilfe, hält es für wichtig, bei allen Diskussionen zu den verschiedenen Themenkomplexen des Kongresses immer die Patientenbelange im Blick zu haben. Dabei dürfe auch der zwischenmenschliche Aspekt der Krebsmedizin nicht vernachlässigt werden. „Der Krebspatient von heute möchte als aktiver, gleichberechtigter Partner angesprochen werden. Die traditionell geprägte Arzt-Patient-Beziehung ist ein Auslaufmodell – der paternalistisch handelnde Arzt hält den heutigen Herausforderungen nicht mehr stand. Die Patienten wollen aktiv zu einer Verbesserung des Krankheitsverlaufes beitragen und mitentscheiden.“ Hierbei gelte es insbesondere, die kommunikativen Kompetenzen von Ärzten und anderen Heilberuflern zu verbessern sowie die Gesundheitskompetenz der Allgemeinbevölkerung und insbesondere der Krebspatienten zu stärken.
Deutlich weniger Neuerkrankungen und Todesfälle seit Einführung der Vorsorge-Darmspiegelung
2002 wurde die Vorsorge-Koloskopie in das gesetzliche Krebsfrüherkennungs-Programm in Deutschland aufgenommen. Zwischen 2003 und 2012 sank die altersstandardisierte Darmkrebs-Neuerkrankungsrate in Deutschland um rund 14 Prozent, wie Wissenschaftler im Deutschen Krebsforschungszentrum nun berechneten. Der Rückgang zeigte sich am stärksten in den Altersgruppen ab 55 Jahren, in denen die Untersuchung angeboten wird. Die altersstandardisierte Darmkrebs-Sterblichkeit sank um fast 21 Prozent bei Männern und sogar um über 26 Prozent bei Frauen.
Die Darmspiegelung ist Früherkennung und zugleich echte „Krebsvorsorge“; da eventuell entdeckte Krebsvorstufen direkt bei der Untersuchung entfernt werden können. Im Oktober 2002 wurde die „Vorsorge-Koloskopie“, so der Fachbegriff, für Versicherte ab 55 Jahren in das gesetzliche Krebsfrüherkennungsprogramm in Deutschland aufgenommen. Zwischen 2003 und 2012 nahmen etwa 20-30 Prozent der Anspruchsberechtigten dieses Angebot wahr.
Hermann Brenner und seine Kollegen im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) haben nun gemeinsam mit Wissenschaftlern vom Krebsregister Saarland und der Universität Lübeck untersucht, ob und in welchem Umfang die Vorsorge-Koloskopie bereits zehn Jahre nach ihrer Einführung Wirkung zeigt.
Da Darmkrebs sich in den meisten Fällen sehr langsam über viele Jahre entwickelt, wird der volle Effekt der Präventionsmaßnahme erst längerfristig zum Tragen kommen. Doch schon zwischen 2003 und 2012 sank die altersstandardisierte Neuerkrankungsrate in Deutschland um 13,8 Prozent bei Männern und um 14,3 Prozent bei Frauen. Die altersstandardisierte Darmkrebs-Sterblichkeit sank um 20,8 Prozent bei Männern und sogar um 26,5 Prozent bei Frauen.
Der starke Rückgang an neu diagnostizierten Darmkrebs-Fällen betraf selektiv die Altersgruppen ab 55 Jahren. Zuvor war die Neuerkrankungsrate über mehrere Jahrzehnte angestiegen, erst im Untersuchungszeitraum kam es zur Trendumkehr. In den Altersgruppen unter 55 Jahren, denen die Vorsorge-Untersuchung nicht angeboten wird, war dagegen kein vergleichbarer Rückgang der Neuerkrankungen zu beobachten.
Die beobachteten Muster sprechen dafür, dass die Vorsorge-Darmspiegelung ganz wesentlich dazu beiträgt, die Darmkrebs-Neuerkrankungsrate und Sterblichkeit in Deutschland zu senken. Nach den längerfristigen Erfahrungen aus den USA erwarten die Wissenschaftler, dass sich dieser Rückgang sowohl der Neuerkrankungsrate als auch der Sterblichkeit in den kommenden Jahren weiter deutlich fortsetzt und noch verstärkt.
„Bei der Koloskopie werden viele Tumoren in einem frühen Stadium mit guten Heilungschancen entdeckt, deshalb geht die Sterblichkeit sogar noch stärker zurück als die Neuerkrankungsrate“, erklärt der Epidemiologe Michael Hoffmeister vom DKFZ. Studienleiter Hermann Brenner ergänzt: „Heute gibt es in Deutschland jedes Jahr mehr als 60.000 Darmkrebs-Neuerkrankungen und mehr als 25.000 Darmkrebs-Todesfälle. Die meisten dieser Fälle könnten durch eine Darmspiegelung vermieden werden – das ist das beste Argument dafür, dieses effektive Vorsorgeangebot zu nutzen!“.
Die Grundlage für die Berechnung der Neuerkrankungsrate waren die Daten der epidemiologischen Krebsregister, für die Berechnung der Mortalität die amtliche Todesursachenstatistik. Längerfristige Trends wurden anhand der Daten des Krebsregisters Saarland ermittelt, das bereits seit langem Krebsfälle vollständig erfasst.
Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum DKFZ (PM 16 08)
Hermann Brenner, Petra Schrotz-King, Bernd Holleczek, Alexander Katalinic, Michael Hoffmeister: Rückgang der Darmkrebs-Inzidenz und Mortalität in Deutschland – Analyse zeitlicher Trends in den ersten 10 Jahren nach Einführung der Vorsorge-Koloskopie – Deutsches Ärzteblatt, 19. Februar 2016
TOP-Infos zu modernen Krebsmedikamenten: Arzneimittel bewertung wird neue Rubrik auf Onkopedia.com
 Prof. Dr. Diana Lüftner, Oberärztin an der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie an der Berliner Charité.
Prof. Dr. Diana Lüftner, Oberärztin an der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie an der Berliner Charité.Mehr Impfen! – Der Krebsprävention eine Chance geben:
Nobelpreisträger Harald zur Hausen ruft anlässlich des diesjährigen Weltkrebstages dazu auf, die Impfung gegen krebserregende humane Papillomviren (HPV) intensiver zu nutzen.
Prof. Dr. Harald zur Hausen, erhielt 2008 den Nobelpreis f. Medizin für seine Arbeit zu HPV Viren.
Bereits 1976 publizierte er die Hypothese, dass humane Papillomviren (Warzenviren) eine Rolle bei der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) spielten. Aus dem Verdacht wurde bald experimentell untermauerte wissenschaftliche Gewissheit. Anfang der 1980er Jahre konnte er mit seiner Arbeitsgruppe erstmals die Typen HPV 16 und HPV 18 des humanen Papillomvirus aus an Gebärmutterhalskrebs erkranktem Gewebe isolieren. Die Entdeckung des Auslösers der bei Frauen dritthäufigsten Krebserkrankung eröffnete völlig neue Perspektiven der Vorbeugung und Behandlung und führte letztlich zur Entwicklung von HPV-Impfstoffen, die seit 2006 verfügbar sind. (Quelle: WIKIPEDIA)“We can. I can.” – das Motto des Weltkrebstags am 4. Februar erinnert daran:
Jeder kann dazu beitragen, sein persönliches Krebsrisiko zu senken, etwa
- durch einen gesunden Lebensstil und
- durch die Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen.
- Eine weitere Möglichkeit, sich vor Krebs zu schützen, ist die Impfung gegen krebserregende humane Papillomviren (HPV). In Deutschland wird die HPV-Impfung für Mädchen im Alter zwischen 9 und 14 Jahren empfohlen. Der kürzlich erschienene Impfreport des Robert Koch-Instituts zeigt jedoch, dass hierzulande gerade mal 29 Prozent der 15-jährigen Mädchen den vollen Impfschutz haben.
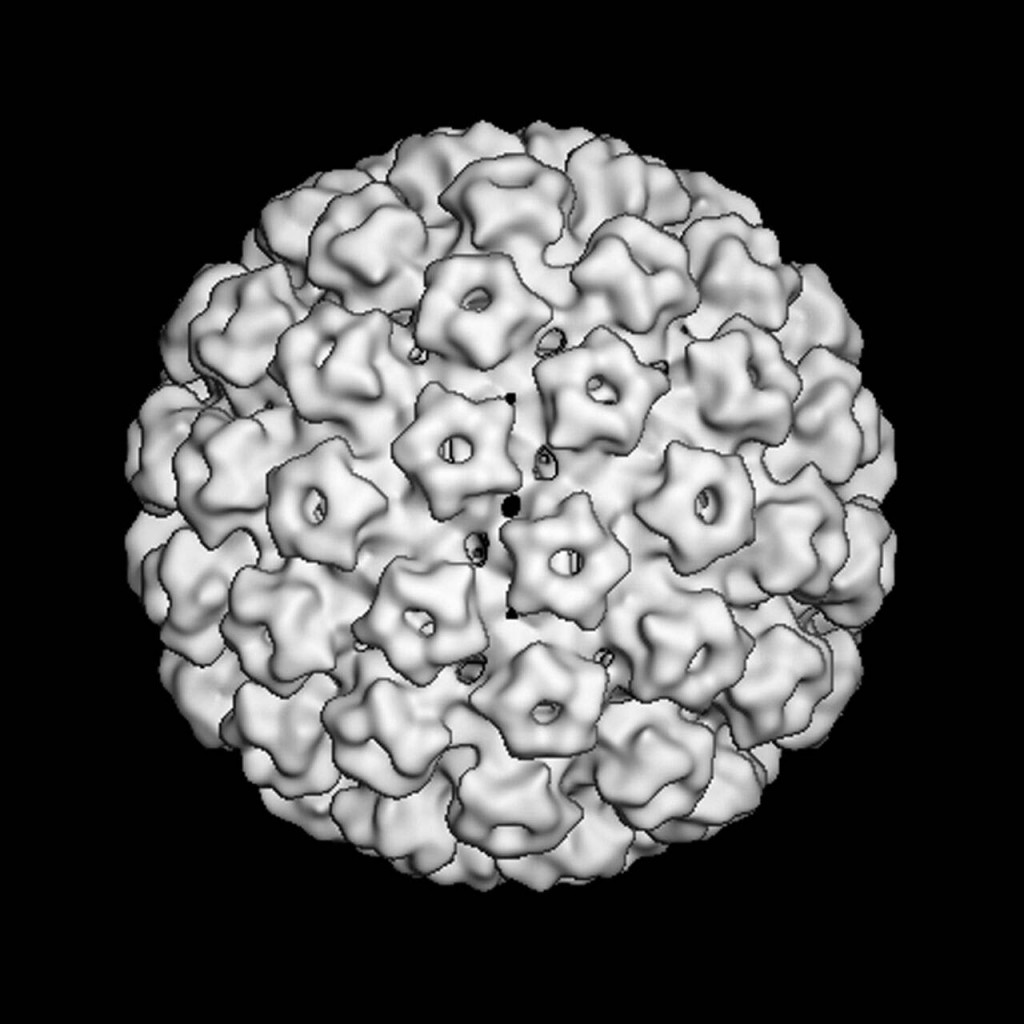
Herr zur Hausen, in Deutschland ist nur etwa ein Drittel der Mädchen gegen HPV geimpft. Woran könnte das liegen?
Zur Hausen: Ein sehr trauriges Ergebnis! Die Hauptursache dafür ist sicherlich, dass Ärzte, medizinisches Personal und Gesundheitspolitiker, aber auch die Kinder und ihre Lehrer und Eltern nicht genügend über die sehr hohe Wirksamkeit und Sicherheit der HPV-Impfung informiert sind. So beobachten wir bei den Geimpften einen nahezu hundertprozentigen Schutz vor Infektion mit HPV 16 und 18, den häufigsten Krebserregern unter den Papillomviren. Bei anderen Impfungen, etwa gegen Hepatitisviren, kommt es dagegen in etwa fünf Prozent der Fälle zu Impfversagern.
Auf der anderen Seite ist die Impfung sehr sicher: Es ist nur eine Nebenwirkung auf etwa eine Million Impfdosen dokumentiert. Und dabei handelt es sich meist nicht um bedrohliche Symptome.
Gibt es bereits Zahlen zum Rückgang von Gebärmutterhalskrebs?
Zur Hausen: Weil es nach einer HPV-Infektion schätzungsweise 15 bis 30 Jahre dauert, bis eine Krebserkrankung festgestellt wird, ist es derzeit noch zu früh für statistisch gesicherte Aussagen zum Rückgang von Gebärmutterhalskrebs unter den Geimpften. Aber der signifikante Rückgang von Krebsvorstufen, aus denen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Krebs entsteht, spricht eine deutliche Sprache.
Sie sind ein Wegbereiter der HPV-Impfung. Wie ist es für sie persönlich, wenn Sie von den niedrigen Impfquoten hierzulande lesen?
Zur Hausen: Ich muss wirklich sagen, das ärgert mich. Was mich noch mehr ärgert als die Verweigerung der Impfung durch Eltern und Kinder, ist die immer wieder beobachtete Ignoranz einiger Mediziner, die sich nicht hinreichend informiert haben. Man muss mal ganz dramatisch darauf hinweisen, was es bedeutet, die Impfung auszulassen: Heute erkranken etwa 6000 Frauen an Gebärmutterhalskrebs und ungefähr 2500 von ihnen sterben daran. Man kann also eine einfache Rechnung anstellen, wie es sich später auswirkt, wenn über die Hälfte der Mädchen nicht geimpft sind.
Wie könnte man den Impfschutz in Deutschland verbessern?
Zur Hausen: Neben einer kontinuierlichen Aufklärung halte ich Impfprogramme in Schulen für sinnvoll. Das machen uns beispielsweise die Briten und Australier vor, dort erreichen die Impfraten über 80 Prozent. Gerade wurde in Hessen ein Modellversuch gestartet, um zu erproben, ob das auch eine Option für Deutschland ist.
Am meisten könnten wir meiner Meinung nach erreichen, wenn auch bei uns die Jungs geimpft würden. Das ist eine geradezu zwingende Forderung, denn in nahezu allen Kulturen haben die jungen Männer mehr Sexualpartner als Frauen der gleichen Altersgruppe und sind damit die wichtigsten Verbreiter der Infektion. Ganz plakativ gesagt: Würden wir nur die Jungs impfen, würden wir wahrscheinlich mehr Fälle von Gebärmutterhalskrebs verhüten als mit der ausschließlichen Impfung der Mädchen!
Gibt es auch gute Nachrichten?
Zur Hausen: Mit den heutigen Impfstoffen gegen HPV16 und 18 lässt sich das Auftreten von Gebärmutterhalskrebs voraussichtlich um 70 Prozent reduzieren, wahrscheinlich sogar um 80 Prozent wegen der Kreuzimmunität. Ein Impfstoff, der gegen neun verschiedene krebserregende HPV-Typen gerichtet ist, wird derzeit klinisch erprobt und könnte vermutlich gegen mehr als 90 Prozent der Krebsfälle schützen. Ein anderes Unternehmen entwickelt sogar einen Impfstoff, der eine Komponente der Virushülle beinhaltet, die in fast allen HPV-Typen vorkommt und damit neben dem Krebsschutz auch Schutz vor vielerlei Warzen verspricht.
Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg
Genetisches Profiling – In der Krebsmedizin ist die genetische Diagnostik mittlerweile unverzichtbar
Anlässlich des 32. Deutschen Krebskongresses 2016 in dessen Rahmen am 27. Februar auch der Krebsaktionstag für Laien und Betroffene angeboten wird, hat die Deutsche Krebsgesellschaft e.V. und die Deutsche Krebshilfe gemeinsam mit der Berliner Krebsgesellschaft drei Referenten interviewt, die wir hier ungekürzt veröffentlichen möchten.
Noch vor wenigen Jahren war die DNA-Sequenzierung ausschließlich ein Werkzeug der Grundlagenforscher zur Entschlüsselung des genetischen Codes. Mittlerweile hat diese Technik Einzug in die Klinik gehalten. Denn Genmutationen, die man im Tumor findet, können wertvolle Informationen für die gezielte Therapieauswahl liefern.
Prof. Dr. Christoph Röcken, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Onkologische Pathologie in der Deutschen Krebsgesellschaft, erklärt im Interview, wie ein genetisches Tumorprofil erstellt wird und beschreibt die Herausforderungen.
Herr Professor Röcken, können Sie Beispiele nennen, wo eine Genveränderung im Erbgut des Tumors heute schon den Weg zur gezielten Therapie weist?
Das gilt mittlerweile beim Dickdarmkrebs, beim Lungenkrebs, beim schwarzen Hautkrebs, bei Hirntumoren und seit 2015 auch beim Eierstockkrebs. Bei diesen Krebsarten erhalten Pathologen häufig den Auftrag, herauszufinden, ob der Tumor bestimmte Mutationen trägt.
Wie wird das Ausgangsmaterial für die Analyse gewonnen?
Wir starten mit Biopsiematerial oder mit Tumorgewebe aus einer OP und fertigen daraus zunächst Gewebeschnitte an. Anschließend grenzen wir unter dem Mikroskop das Tumorareal ein und berücksichtigen dabei die Heterogenität des Tumors. Die fraglichen Areale werden gezielt herauspräpariert (mikrodisseziert), man gewinnt daraus die DNA und untersucht sie anschließend mit einer DNA-Sequenzierung auf Mutationen.
Welche Sequenzierungsmethoden kommen dabei zum Einsatz?
In der diagnostischen Routine geht es häufig um die Frage, ob ein bestimmtes Gen eine bestimmte Mutation trägt. D.h. der entsprechende Gen-Abschnitt wird zunächst vervielfältigt und dann einer klassischen Sanger-Sequenzierung unterzogen. Mittlerweile sind aber viele Gene bekannt, die in der Diagnostik und Therapie eine Bedeutung haben. Will man die alle mit der klassischen Methode überprüfen, muss man jedes Gen einzeln sequenzieren – ein enormer Zeitaufwand. Das Next Generation Sequencing, kurz NGS, erlaubt die parallele Sequenzierung vieler Gene. Damit lassen sich z. B. 10 bis 40 Gene auf einmal untersuchen, und zwar in einer sogenannten Panel-Sequenzierung. Das steigert die Effizienz der Sequenzierung enorm.
Mit sogenannten Liquid Biopsies wollen die Experten mittlerweile auch im Blut nach der mutierten Krebs-DNA suchen. Wie zuverlässig ist diese Diagnostik?
Dass Tumor-DNA oder auch Tumorzellen im Blut vorkommen, weiß man schon länger. Hämatologen nutzen das bei bestimmten Leukämien, und zwar zur Bestimmung der Resterkrankung nach der Therapie. Diese Leukämien tragen eine charakteristische Mutation; je geringer die Konzentration an mutierter DNA im Blut, desto geringer die minimale Resterkrankung. Auch solide Tumoren können beim Untergang von Tumorzellen DNA ins Blut freisetzen. Das gilt allerdings nicht für alle Tumorarten in jedem Tumorstadium. Annähernd 100% der Patienten mit fortgeschrittenem Darmkrebs weisen zirkulierende Tumor-DNA im Blut auf, nur 40% beim Prostata- oder Nierenkarzinom, und beim Hirntumor findet man gar keine Tumor-DNA im Blut.
Gibt es noch weitere Einschränkungen?
Man muss die Mutation, nach der gesucht werden soll, genau kennen. Eine Liquid Biopsy zur Suche nach einer Genveränderung, die der Tumor gar nicht trägt, macht keinen Sinn. An der Erstellung eines genetischen Profils des Tumors kommt man also nicht vorbei. Außerdem kommen einige der Mutationen, die wir in bösartigen Tumoren finden, auch bei gutartigen Tumoren vor. Insgesamt ist also noch einiges an Standardisierung und Qualitätssicherung nötig, bevor die Liquid Biopsy bei Patienten mit soliden Tumoren routinemäßig angewendet werden kann. Zur Überprüfung des Therapieansprechens bei Patienten mit einer hohen Tumorlast könnten Liquid Biopsies aber durchaus nützlich sein.
Was verändert sich durch die genetische Diagnostik in der Pathologie?
Für die Einteilung von Tumoren ist sie mittlerweile unverzichtbar und ich sehe darin eine große Chance, um die Therapie noch genauer auf die Biologie des Tumors abstimmen zu können. Natürlich unterliegt diese Art der Diagnostik einer großen Dynamik, und wir sind gefordert, mit dem raschen Zuwachs an Wissen und der Entwicklung neuer Methoden Schritt zu halten. Deshalb sind Kongresse wie der DKK 2016 wichtig, bei dem die Experten zusammenkommen, um ihr Wissen auszutauschen. Vor allem im translationalen Programmteil des DKK 2016 sind die Themen Molecular Diagnostics, Next Generation Sequencing und Liquid Biopsy vertreten. Ich verspreche mir interessante Beiträge und spannende Sitzungen vom DKK 2016.
Quelle: Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe