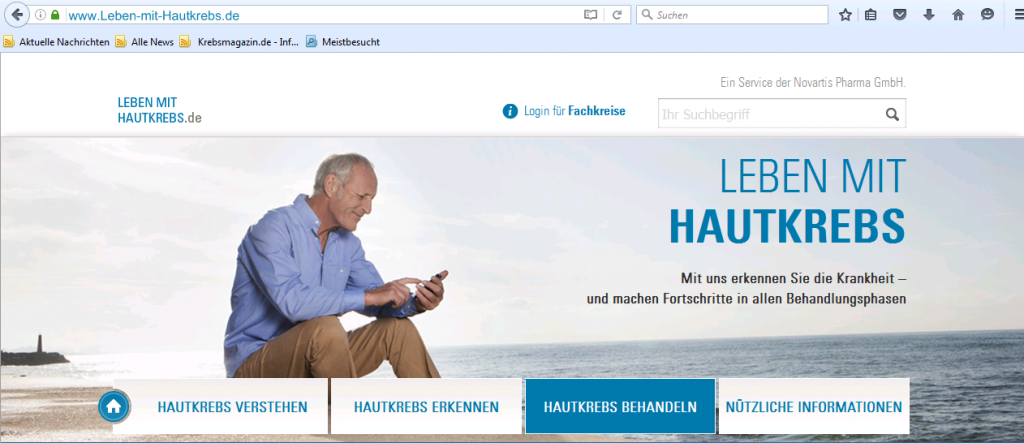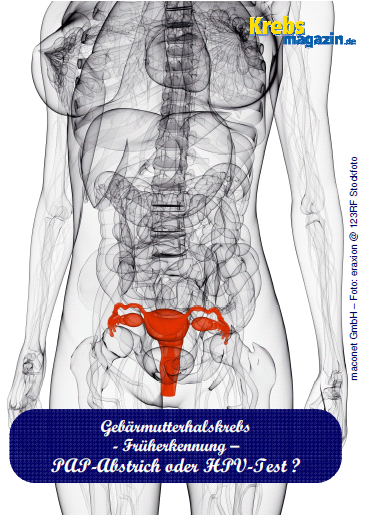Archiv für die Kategorie „Krebserkrankungen“
Den Menschen therapieren, nicht nur den Tumor – Lebensqualität steht bei Jahreskongress der Strahlentherapeuten im Fokus
Krebspatienten können durch ihre Erkrankung und deren Symptome schwer belastet sein. Doch auch die Therapie des Tumors kann sie zusätzlich beeinträchtigen: Operation, Chemotherapie und Bestrahlung können Nebenwirkungen und Spätfolgen haben, die die Lebensqualität der Betroffenen einschränken. „Der gesundheitliche Preis, den Patienten für Heilung oder Lebensverlängerung zahlen müssen, ist in den vergangenen zwanzig Jahren immer stärker in den Fokus der Medizin gerückt“, sagt Tagungspräsident Professor Dr. med. Frederik Wenz. Auf der 22. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) vom 16. bis 19. Juni 2016 in Mannheim wird die Lebensqualität der Patienten nun ein Schwerpunktthema sein.
Die Experten der DEGRO stellen auf ihrer Jahrestagung in Mannheim neue Bestrahlungstechniken und Begleitbehandlungen vor, die zum Erhalt oder zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. „Lebensqualität ist ein ganzheitlicher Begriff, der nicht nur körperliche Aspekte umfasst, sondern auch psychische und soziale“, sagt Professor Dr. med. Dirk Vordermark, Direktor der Klinik für Strahlentherapie am Universitätsklinikum Halle (Saale) und Sprecher der DEGRO-Arbeitsgruppe „Lebensqualität und Ethik in der Radioonkologie“.
Ärzte können die Lebensqualität ihrer Patienten jedoch oft nicht richtig einschätzen. So empfinden einige Patienten diese selbst in der Endphase einer unheilbaren Krebserkrankung als gut. Andere, die ihren Krebs bereits überwunden haben und als geheilt gelten, leiden hingegen unter starken Belastungen und Einschränkungen. Als Beispiel nennt Vordermark die Therapie von Prostatatumoren, die oft Inkontinenz oder Impotenz nach sich ziehen kann, oder Sprech- und Schluckstörungen, die durch die Behandlung von Tumoren im Halsbereich entstehen können.
„Lebensqualität ist immer subjektiv“, sagt Dirk Vordermark. „Die Schwierigkeit besteht darin, sie zu objektivieren und messbar zu machen.“ Eine Möglichkeit hierfür bieten standardisierte und auf die jeweilige Krebsart abgestimmte Fragebögen, die von der Quality of Life Group der European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) entwickelt wurden.
Mithilfe der Fragebögen schätzen die Patienten selbst ihre Lebensqualität ein. Das Ergebnis ist ein Zahlenwert, der Vergleiche erlaubt. „Wenn die Patienten vor, während und nach der Behandlung befragt werden, können so die Auswirkungen der Therapie auf die Lebensqualität untersucht werden“, erläutert Vordermark. Das sei sowohl bei heilenden, als auch bei palliativen, also lindernden Therapieansätzen wichtig. Ist das Ziel die Heilung, werden kurzfristig auch stärkere Nebenwirkungen in Kauf genommen. Langfristig soll der Patient aber so wenige Einschränkungen wie möglich davontragen. Wird die Strahlentherapie jedoch palliativ eingesetzt, soll sie dazu beitragen, die Lebensqualität rasch zu stabilisieren oder gar zu verbessern.
Wie weit die Lebensqualität des einzelnen Patienten im Klinikalltag mithilfe von Fragebögen erfasst werden kann, wird derzeit in Pilotstudien geprüft. „Solche Rückmeldungen einzuholen ist sehr aufwendig, aber lohnenswert“, sagt Tagungspräsident Wenz, der die Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Universitätsklinikum Mannheim leitet. Denn wenn der Tumor zwar kleiner werde, es dem Patienten aber subjektiv schlechter gehe, sei nicht viel gewonnen.
Die technischen Fortschritte in der Strahlentherapie ermöglichen es heute, den Tumor gezielt zu bestrahlen und zugleich das gesunde Gewebe zu schonen. „Wir haben bereits viel darüber gelernt, welche Therapiekonzepte und welche Strahlendosis zu einer möglichst guten Lebensqualität führen“, erklärt der DEGRO-Experte. „Allerdings müssen wir dieses Wissen weiter ausbauen, sodass die Patienten noch mehr davon profitieren.“
Quelle: DEGRO – Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie e.V.
Junge Menschen mit Krebs erleben eine mehrfache Existenzbedrohung
Pro Jahr erkranken circa 15.000 junge Frauen und Männer im Alter von 18 bis 39 Jahren an Krebs. Dabei werden die jungen Erwachsenen mit weit mehr als den unmittelbaren medizinischen Problemen konfrontiert.
Es entstehen besondere soziale und finanzielle Problemlagen, das Armutsrisiko ist signifikant erhöht. Im Rahmen der 7. Berliner Stiftungswoche diskutierten Mediziner aus dem Bereich der Onkologie, Sozial- und Rehabilitationsmedizin, Politiker aus dem Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages sowie Patientinnen und Patienten unter der Überschrift “Jung, an Krebs erkrankt und von Armut bedroht?“ im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Darüber hinaus stellte die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs das bundesweit einzigartige “JUNGE KREBSPORTAL” vor.
“Die Krebserkrankung nahm mir die Kontrolle über meine Zukunft”, fasste eine junge Patientin auf der Podiumsdiskussion zum Thema “Jung, an Krebs erkrankt und von Armut bedroht?”der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs Mittwoch (20.4.2016) im ARD-Hauptstadtbüro in Berlin ihre Situation zusammen. “Die diesjährige Stiftungswoche steht unter dem Motto ‘Von der Würde des Menschen’. Warum machen wir mit? Junge Krebspatienten geraten schnell in soziale und finanzielle Schieflagen. Lücken und Härten im Gesundheitssystem, der Abbruch von Ausbildung, Beruf oder Studium – all das kann schnell zu einer tatsächlichen Verarmung führen”, erklärt Prof. Dr. med. Mathias Freund, Kuratoriums-vorsitzender der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs.
Dabei, so Freund, sei Armut nie nur eindimensional. Armut hat existentielle Folgen und kann darüber hinaus aber auch zu sozialer Ausgrenzung führen. “Und wenn wir von Armut sprechen, müssen wir auch von Würde reden”, so Freund weiter.
An der in direkter Nachbarschaft des Bundestages stattfindenden Diskussionsrunde der bundesweit tätigen Stiftung nahmen junge Patientinnen und Patienten, die an Krebs erkrankt sind und mit der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs zusammenarbeiten, sowie Expertinnen und Experten, wie Prof. Dr. med. Mathias Freund, Priv.-Doz. Dr. med. Ulf Seifart, Chefarzt der DRV-Klinik “Sonnenblick” in Marburg, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Stiftung sowie wissenschaftlicher Leiter des Projektes JUNGES KREBSPORTAL der Stiftung und Tino Sorge, MdB, ordentliches Mitglied im Ausschuss Gesundheit des Deutschen Bundestages, Berichterstatter für Gesundheitswirtschaft und Gesundheitsforschung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, teil. Die bekannte Fernsehmoderatorin und Journalistin des Rundfunks Berlin-Brandenburg Britta Elm leitete die Runde. Gemeinsam mit dem Publikum diskutierten deren Teilnehmer über die Verbesserung der Situation von Krebspatientinnen und -patienten dieser speziellen Alterskohorte und zeigten konkrete Lösungsansätze auf.
“Erkrankte sollten sich zunächst ausschließlich ihrer Heilung widmen können und sich nicht Gedanken über soziale und berufliche Stigmatisierung oder wirtschaftliche Schwierigkeiten machen müssen. Dies bedingt verstärkt auch psychoonkologische Betreuungsangebote sowie Unterstützungshilfen, z.B. in berufs-, kranken- und renten-rechtlichen Fragen”, sagt der Bundestagsabgeordnete Sorge und ergänzt: “Gleichzeitig müssen Forschungsanstrengungen, aber auch unsere sozialen Sicherungs- und Informationssysteme, junge Krebserkrankte stärker in den Fokus rücken. Über die psychischen und physischen Belastungen hinaus, stellt eine Krebserkrankung junge Patienten gerade im Hinblick auf die familiäre und berufliche Lebensplanung vor zusätzliche Herausforderungen. Wir brauchen neben einer offensiveren öffentlichen Debatte umfassendere Unterstützungsangebote für diese Patientengruppe.”
Die Diagnose Krebs bedeutet für junge Menschen eine mehrfache existenzielle Bedrohung – nicht nur gesundheitlich, sondern auch finanziell und sozial. Die Auswirkungen der durch die Krebserkrankung erzwungenen Unterbrechung von Ausbildung oder Studium spielen eine sehr große Rolle. Das Bedürfnis, nach der Erkrankung in den Arbeitsmarkt zurückzukehren oder überhaupt erst aufgenommen zu werden, ist immens.
“Wenn man vorher nicht schon ausgebildet war oder gearbeitet hat und damit mindestens zwei Jahre in die Rentenversicherung einzahlte, ist man ziemlich ‘aufgeschmissen’. Und der Weg zurück zu den Eltern fällt vielen schwer – wenn er überhaupt möglich ist. Sollte man vor dem Studium schon in die Rente eingezahlt haben, scheuen sich viele, diese zu beantragen, da bei einem positiven Krankheitsverlauf die Rückkehr in den Arbeitsmarkt deutlich schwieriger ist”, betont ein junger Patient aus eigener Erfahrung.
In der Podiumsdiskussion wurde auch das bundesweit einzigartige JUNGE KREBSPORTAL der Stiftung, das im November 2015 eröffnet wurde, präsentiert. Sozialmedizinerinnen und -mediziner bieten den jungen Betroffenen im Online-Chat, telefonisch oder im persönlichen Gespräch schnelle, unkomplizierte, kompetente und kostenlose Antworten auf Fragen aus ihrem privaten und beruflichen Alltag im Umfeld der Krebserkrankung. “Zu den Problemen und besonderen Bedürfnissen von jungen Erwachsenen mit Krebs gibt es in Deutschland viel zu wenig systematische Untersuchungen. Daher wird die Stiftung hier Pionierarbeit leisten, die Forschung in diesem Bereich fördern und so die überfälligen gesundheitspolitischen Debatten anstoßen. Wir werden konkrete Forderungen aufstellen und so dazu beitragen, bestehende Versorgungslücken zu schließen”, erklärt Freund.
Die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs ist im Juli 2014 von der DGHO – Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e.V. gegründet worden. Ihre Arbeit ist als gemeinnützig anerkannt und wird ausschließlich aus Spenden finanziert. Junge krebskranke Erwachsene benötigen eine spezielle medizinische Behandlung und Versorgung. Die Stiftung setzt sich für die Verbesserung der Therapiemöglichkeiten und der Nachsorge junger Krebspatientinnen und -patienten ein und ist gleichzeitig Ansprechpartner für Patienten, Angehörige, Wissenschaftler, Unterstützer und die Öffentlichkeit.
Quelle: Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs
Spendenkonto:
Postbank, IBAN: DE57 1001 0010 0834 2261 04
BIC: PBNKDEFF
Gebärmutterhalskrebs: Individualisierte Nachsorge – Molekularer Fingerabdruck überführt erneute Krebsvorstufen
In einer klinischen Beobachtungsstudie untersuchen Wissenschaftler des Universitätsklinikums Jena eine neue Methode zur Nachsorge nach der operativen Entfernung von Krebsvorstufen am Gebärmutterhals. Dabei nutzen sie charakteristische DNA-Stellen, die bei der Verschmelzung des krebsauslösenden humanen Papillomvirus mit dem menschlichen Erbgut entstehen, als individualisierten Biomarker für den Nachweis wiederauftretender Krebsvorstufen. Die ATLAS Biolabs GmbH ist Projektpartner in der multizentrischen Studie, in die ab Mai insgesamt 670 Patientinnen eingeschlossen werden sollen und die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit insgesamt 750.000 Euro gefördert wird.
In Deutschland werden jährlich etwa 90.000 Frauen wegen Krebsvorstufen am Gebärmutterhals operiert. Ob die von einer langanhaltenden Infektion mit Papilloma-Viren (HPV) verursachte Gewebeveränderung erneut auftritt, wird in der Nachsorge anhand von Zelluntersuchungen und des Tests auf Virus-DNA regelmäßig kontrolliert. Diese finden mit großer Sicherheit eine eventuelle erneute Krebsvorstufe, schlagen aber auch oft Alarm, wenn es sich um eine harmlose HPV-Neuinfektion handelt. Um den Patientinnen diese Verunsicherung und klärende Folgeuntersuchungen ersparen zu können, testen Jenaer Wissenschaftler jetzt in einer klinischen Studie einen molekulargenetischen Nachweis, der zwischen einer HPV-Neuinfektion und Zellveränderungen aufgrund der ursprünglichen Virusinfektion unterscheiden kann.
„Bei der Entstehung von Krebsvorstufen kommt es häufig zur Verschmelzung zwischen dem Virus-Genom und dem menschlichen Erbgut. Diese Virus-Integrationsstellen sind für jeden Infektionsfall einzigartig“, erklärt Prof. Dr. Matthias Dürst von der Universitätsfrauenklinik Jena die wissenschaftlichen Grundlagen des Verfahrens. „Diese charakteristischen Spuren wollen wir wie einen Fingerabdruck nutzen und als molekularen Marker verwenden.“ Der Molekularbiologe leitet die klinische Studie mit deutschlandweit 14 Zentren. In diesen sollen ab Mai 2016 etwa 670 Patientinnen in die Untersuchung aufgenommen werden, denen Krebsvorstufen am Gebärmutterhals entfernt werden mussten.
Molekularer Fingerabdruck als individueller Biomarker
Bei diesen Patientinnen wird als individueller Biomarker die Integrationsstelle der Virus-DNA für die Zellen des entfernten Gewebes bestimmt, also der Fingerabdruck ihrer Krebsvorstufe. Matthias Dürst: „Das wird durch eine hochspezifische Anreicherungsmethode in Verbindung mit einer modernen Hochdurchsatz-Sequenzierung möglich, die am Deutschen Krebsforschungszentrum entwickelt wurde.“
Kooperationspartner hierfür ist die ATLAS Biolabs GmbH in Berlin und Köln. Im Verlauf von zwei Jahren werden dann die Befunde des normalen Nachsorgeprogramms, das die Patientinnen durchlaufen, verglichen mit dem Test auf diesen individuellen Biomarker. Ergibt dieser eine Übereinstimmung zwischen der entfernten Krebsvorstufe und dem Nachsorgeabstrich, so handelt es sich um ein erneutes Auftreten der Erkrankung. Der Nachweis von HPV-DNA ohne passendes Integrationsmuster bedeutet eine Neuinfektion, die zunächst keine weitere operative Abklärung erfordern würde. „Auf diese Weise wollen wir künftig zahlreichen Frauen unnötige Aufregung und Operationen ersparen“, so Prof. Dr. Ingo Runnebaum, Direktor der Universitätsfrauenklinik Jena.
Die Klinik bietet Patientinnen mit Krebsvorstufen eine spezialisierte Dysplasie-Ambulanz an, die als erste in Deutschland von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert wurde. Im vergangenen Jahr wurden hier etwa 1800 Patientinnen betreut, mehr als 170 von ihnen mussten wegen einer schwergradigen Krebsvorstufe des Gebärmutterhalses operativ behandelt werden.
Das auf insgesamt vier Jahre angelegte Studienprojekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit insgesamt 750.000 Euro gefördert. „Unser Ziel ist es, die diagnostische Genauigkeit des neuen molekularen Biomarkers zu belegen und den Test als individualisierte Krebsnachsorgemöglichkeit in der Klinik zu implementieren“, so Professor Dürst. Dr. Karsten R. Heidtke, Forschungsdirektor der ATLAS Biolabs GmbH, ergänzt: „Dank des Technologietransfers und der interdisziplinären Zusammenarbeit können aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zügig in die Laborpraxis umgesetzt werden. Das ist ein vielversprechender Weg, neue innovative HPV-Prüfverfahren zu etablieren und zu erweitern“.
Quelle: Universitätsklinikum Jena
Darmkrebs: EuropaColon nimmt Arbeit als spezialisierte Anlaufstelle und Interessenvertretung für Darmkrebspatienten auf
Mit einem Pressegespräch am 19. April 2016 nimmt EuropaColon Deutschland e. V. seine Tätigkeit als spezialisierte Anlaufstelle und Interessenvertretung von Darmkrebspatienten auf. Der neu gegründete Verein ist die deutsche Tochter der seit zwölf Jahren europaweit aktiven Patientenorganisation EuropaColon, die in 24 Ländern Europas Menschen mit Darmkrebs unterstützt und gegenüber der Gesundheitspolitik für deren Interessen eintritt. Der Verein soll Anlaufstelle für Darmkrebspatienten werden und möchte zu einer besseren, individualisierten
Vorsorge und einer optimalen Behandlung von Darmkrebs in Deutschland beitragen.
Erschreckende Zahlen
Wenn Darmkrebs früh genug erkannt wird, ist er gut zu behandeln. In Deutschland sterben aber jährlich immer noch mehr als 25.000 Menschen an den Folgen der Krankheit und es werden über 62.000 Neuerkrankungen diagnostiziert. Von den Erkrankten in Deutschland sind 15 – 20 % familiär vorbelastet. Für diese Gruppe setzen die Vorsorgeprogramme einfach zu spät an. Viele der Betroffenen erkranken schon lange vor dem 50. Lebensjahr, ab dem die Vorsorge und Früherkennung von den Kassen erstattet wird.
Ein Drittel der Darmkrebspatienten weist zum Zeitpunkt der Erstdiagnose bereits Metastasen auf, meist in der Leber – und auch dort kann sich der Krebs lange Zeit ausbreiten, bevor er Beschwerden verursacht. Diese Metastasen sind nach wie vor schwer zu besiegen, auch wenn heute bereits neue Therapieoptionen teilweise zu beeindruckenden Behandlungserfolgen führen.
Bewusstsein, politischer Wille und konsequentes Handeln
„Seit über zehn Jahren ist es oberstes Ziel von EuropaColon, dass Menschen nicht mehr durch Darmkrebs und seine Folgeerkrankungen sterben und dass die Lebensqualität von Patienten besonders mit fortgeschrittenem Darmkrebs verbessert wird“, sagt Jola Gore-Booth, Gründerin und Geschäftsführerin des europäischen Dachverbandes EuropaColon. Der Verein werde seine Arbeit in Zukunft sukzessive auch auf andere Tumoren des Verdauungstraktes ausweiten.
 Wolfram Nolte, 1. Vorsitzender EuropaColon Deutschland e.V.
Wolfram Nolte, 1. Vorsitzender EuropaColon Deutschland e.V.
Deutschland hat gegenüber anderen europäischen Ländern Nachholbedarf. Das betrifft einerseits die eigenverantwortliche Teilnahme an den Vorsorgeprogrammen. Andererseits fehlt aber auch der politische Wille, lange vorliegende Pläne umzusetzen, die Vorsorge schnell und konsequent auf ein organisiertes Screening umzustellen und neue Therapien allen zugänglich zu machen. Vor allem geht es jetzt darum, ein risikoadaptiertes Screening einzuführen und den Menschen mit metastasiertem Darmkrebs den Zugang zu den besten Therapieoptionen zu eröffnen. „Wir arbeiten darauf hin, dass Deutschland nun endlich vom opportunistischen zum organisierten Screening übergeht, um die Bevölkerung effektiver vor der tückischen Krankheit zu schützen“, erläutert Wolfram Nolte, erster Vorsitzende von EuropaColon Deutschland e. V. Da bisher viele Menschen zu spät diagnostiziert würden, bedürften aber auch diejenigen besonderer Hilfe, bei denen der Krebs schon gestreut habe. „Besonders die Patienten, denen nur noch wenige Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen, brauchen unsere Unterstützung“, so Nolte. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen, die sich der Prävention von Darmkrebs und der konsequenten Anwendung moderner Therapien gegen die Krankheit und ihre Folgen verpflichtet fühlen.“
„Evidenzbasierte Präzisionsmedizin fördern“
 Prof. Dr. Gabriela Möslein, Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates, Zentrum f. heriditäre Tumorerkrankungen am HELIOS Universitätsklinikum Wuppertal
Prof. Dr. Gabriela Möslein, Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirates, Zentrum f. heriditäre Tumorerkrankungen am HELIOS Universitätsklinikum Wuppertal
EuropaColon Deutschland e. V. baut gerade einen wissenschaftlichen Beirat auf, der den Verein fachlich unterstützt und berät. „Wir benötigen neue Konzepte, um die dramatisch wachsende Zahl der in frühen Jahren erkrankenden Patienten ausreichend zu reduzieren. Auch für die familiär vorbelasteten Betroffenen hat unser Gesundheitssystem noch keine effizienten Strukturen aufgebaut“, erläutert Frau Prof. Möslein. „Ebenso müssen wir den Patienten mehr Beachtung schenken, deren Darmkrebs bei der Erstdiagnose schon gestreut hat. Das ist jeder dritte Patient! Ihnen müssen wir alle Therapieoptionen zu gute kommen lassen, die die moderne evidenzbasierte Präzisionsmedizin uns bietet. Zum Beispiel könnten systematische und durchaus preiswerte Tests wie die immunhistochemische Färbung der sogenannten MMR-Gene (Mismatch-Reparatur-Gene) wertvolle Informationen zur optimalen Behandlung liefern.“ Die Kosten-Nutzen-Rechnung ist eindeutig zu Gunsten dieses Vorgehens und der Nutzen für den einzelnen Betroffenen Patienten ist unschätzbar hoch.
Über EuropaColon
EuropaColon hat sich zum Ziel gesetzt, Patienten, Mediziner und Gesundheitspolitik im Kampf gegen Darmkrebs zu vereinen. Der europaweit tätige Verband ist direkte Anlaufstelle für Patienten und setzt sich dafür ein, dass Richtlinien auf EU-Ebene etabliert und auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Dazu arbeitet EuropaColon eng mit Unternehmen und anderen Organisationen in ganz Europa zusammen. Die Organisation ist derzeit in 24 Ländern Europas vertreten.
Quelle: EuropaColon Deutschland e.V.
Weitere Infos: http://www.europacolon.de
Hautkrebs: Novartis Pharma startet neues Informationsangebot mit www.leben-mit-hautkrebs.de
Hautkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen weltweit. Allein in Deutschland gibt es jährlich über 263.800 Neuerkrankungen.
Eine nützliche Informationsquelle zum vielschichtigen Themenspektrum Hautkrebs bietet die neue Website www.leben-mit-hautkrebs.de. Das Serviceangebot von Novartis Oncology richtet sich an Patienten, Angehörige und Interessierte. Umfangreiche Hintergrundinformationen zur Erkrankung sowie zu Erkennungsmöglichkeiten, Therapieprinzipien und Behandlungsmethoden können Betroffene in verschiedenen Phasen der Erkrankung unterstützen. Als weitere Services stehen beispielsweise praktische Tipps zur Selbstuntersuchung und ein Leitfaden für das Gespräch mit dem behandelnden Arzt zum Download zur Verfügung.
Um Aufmerksamkeit für die Erkrankung und Vorsorge zu schaffen, wurde sogar der Monat Mai zum Hautkrebsmonat ausgerufen. Denn gerade mit Beginn der warmen Jahreszeit zieht es viele ungeschützt in die Sonne, wodurch das Risiko für Hautkrebs steigen kann.
Die gute Nachricht: Die meisten Hautkrebsarten lassen sich gut behandeln. Doch gibt es auch bösartige Hautkrebsvarianten: Das maligne Melanom, auch „schwarzer Hautkrebs“ genannt, stellt die aggressivste Form von Hautkrebs dar und neigt dazu, andere Körperbereiche zu befallen. Die Behandlung vom schwarzen Hautkrebs ist erschwert und die Prognose für den Patienten meist ungünstig.
Hautkrebs verstehen – erkennen – behandeln
„leben-mit-hautkrebs.de“ bündelt Informationen zum Krankheitsbild und liefert Antworten auf häufige Fragen aus Patientensicht. So werden Ursachen und Risikofaktoren, die für die Entstehung von Hautkrebs eine Rolle spielen können, umfassend beleuchtet sowie bewährte Diagnose- und Screeningverfahren allgemeinverständlich vorgestellt. Das verfügbare Behandlungsspektrum wird von operativen Verfahren oder Bestrahlungs- und Chemotherapie bis hin zu modernen, zielgerichteten medikamentösen Therapien differenziert abgebildet. Verlinkungen zu Selbsthilfegruppen oder weiterführenden Informationsquellen inklusive Tipps für die Arztsuche runden das Angebot ab.
Das ABC der Selbstkontrolle: Warnsignale richtig deuten
Je früher Hautkrebs erkannt wird, desto günstiger sind oftmals die Heilungschancen.4 Neben den Vorsorgeuntersuchungen der gesetzlichen Krankenkassen können Patienten selbst einen entscheidenden Beitrag zur Früherkennung von Hautveränderungen leisten. Die ABCDE-Regel5 ist ein bewährtes Instrument, um Auffälligkeiten und erste Warnsignale für ein Melanom zu erfassen und im Gespräch mit dem behandelnden Arzt anzumerken. Darüber hinaus bietet „leben-mit-hautkrebs.de“ eine Checkliste um festzustellen, ob individuelle Hautmerkmale möglicherweise auf ein potenziell erhöhtes Erkrankungsrisiko hindeuten. Die Selbsteinschätzung sollte anschließend gemeinsam mit einem Dermatologen besprochen werden.6
Checkliste zur Selbsteinschätzung des Hautkrebsrisikos für das Gespräch beim Hautarzt
□ Meine Haut bräunt leicht, beim Sonnen habe ich keine Probleme
□ Bei mir kommt es immer schnell zu Sonnenbrand
□ Meine Haut ist blass, ich habe Sommersprossen
□ Ich habe Verwandte mit blasser Haut und Sommersprossen
□ Ich habe so gut wie keine Pigmentmale
□ Ich habe viele Pigmentmale
□ Ich habe Pigmentmale, die seit Jahren unverändert sind
□ Ich habe nur Pigmentmale, die kleiner als zwei Millimeter sind
□ Einige meiner Pigmentmale sind größer als zwei Millimeter
□ Ich habe ein Pigmentmal, das angeboren und größer als zwei Zentimeter ist
□ Ein Pigmentmal ist in letzter Zeit neu entstanden
□ Mit einem meiner Pigmentmale könnte etwas nicht in Ordnung sein
Quelle: Novartis Pharma GmbH – vom 4. April 2016
ZNS-Lymphome: Neuer Therapieansatz bei aggressivem Hirntumor
Die Therapie des primären ZNS-Lymphoms, einer seltenen und sehr aggressiven Lymphom- bzw. Hirntumorart, ist ausgesprochen schwierig. Vor allem Patienten, die nicht auf die Ersttherapie ansprechen oder einen Rückfall erleiden, haben eine schlechte Prognose. In der internationalen Fachzeitschrift Journal of Clinical Oncology (JCO) haben Wissenschaftler der Deutschen Studiengruppe für Primäre ZNS-Lymphome (G-PCNSL-SG) mit Sitz an der Charité Berlin nun die Ergebnisse einer Phase-II-Studie mit dem Wirkstoff Temsirolimus publiziert. Zwar stellen die Ergebnisse keinen Therapiedurchbruch dar, eröffnen aber neue Perspektiven für Patienten und dokumentieren den Erfolg deutscher Wissenschaftler in der Hirntumorforschung.
Primäre ZNS-Lymphome sind Gewebeneubildungen (= lymphatische Neoplasien), die zum Zeitpunkt der Erstdiagnose auf das zentrale Nervensystem (ZNS), insbesondere das Gehirn und das Nervenwasser, begrenzt sind. Die meist sehr aggressiven Lymphome können durch Therapien mit Zytostatika, die die Blut-Hirn-Schranke passieren, oder durch Ganzhirnbestrahlung manchmal über mehrere Jahre zurückgedrängt werden. In einigen Fällen gelingt sogar eine Heilung. Allerdings spricht etwa ein Viertel der Patienten auf die primäre Therapie nicht an und mehr als die Hälfte erleidet ein Rezidiv.
Für diese erfolglos vorbehandelten Patienten haben Ärzte und Wissenschaftler der Deutschen Studiengruppe für Primäre ZNS-Lymphome (G-PCNSL-SG) mit Sitz an der Charité Berlin eine Phase-II-Studie mit dem Wirkstoff Temsirolimus als Monotherapie durchgeführt. Das zielgerichtete Medikament, das bereits bei anderen rezidivierten Lymphomen eine Wirksamkeit bei tolerablen Nebenwirkungen zeigte, hemmt den mTOR-Signalweg und blockiert damit einen Mechanismus, der für das Überleben der Tumorzellen wichtig ist.
„Aufgrund seines Wirkprofils und der Hinweise darauf, dass Temsirolimus in der Lage ist, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren, wollten wir die Wirksamkeit dieses Medikaments auch bei Patienten mit primären ZNS-Lymphomen (PZNSL) untersuchen“, erläutert Dr. Agnieszka Korfel, Oberärztin der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie der Charité und Leiterin dieser klinischen Prüfung die Studienergebnisse. „Bei dieser ersten abgeschlossenen prospektiven Studie mit einem zielgerichteten Medikament beim PZNSL zeigte sich, dass die Substanz beim rezidivierten ZNS-Lymphom erstaunlich aktiv ist, bei unserem Patientenkollektiv allerdings mit einer nicht unerheblichen Toxizität einherging“, erläutert die Ärztin und Wissenschaftlerin die Ergebnisse.
In die Studie waren nur Patienten eingeschlossen worden, bei denen die Krankheit nach teilweise mehreren Vortherapien weiter fortgeschritten bzw. zurückgekehrt war, darunter auch sieben Patienten, die eine Hochdosistherapie mit autologer Stammzelltransplantation erhalten hatten. Im Rahmen der Studie bekamen die Patienten einmal pro Woche intravenös entweder 25 mg (die ersten sechs Patienten) oder 75 mg (alle weiteren Patienten) Temsirolimus über einen Zeitraum von maximal 12 Monaten.
Von den insgesamt 37 Patienten sprachen 20 Patienten auf die Therapie an (ORR = 54 % [95% CI 37%-71%]), bei einigen Patienten (n=6, 16%) hielt die Remission über einen Zeitraum von mehr als fünf Monaten an. Allerdings ließ sich das Ansprechen nicht für alle Patienten in ein vergleichsweise längeres progressionsfreies Überleben (PFS) übertragen: Das mediane PFS betrug insgesamt 2,1 Monate (95% CI 1,1-3,0) bei einem 1-Jahres PFS von 5,4 % [95% CI >0-11,2]. Das mediane Gesamtüberleben (OS) lag bei 3,7 Monaten [95% CI 1,5-5,8] mit einem 1-Jahres OS von 19% [95 CI 6,1-37,7] sowie einem 2-Jahres OS von 16,2 % [95% CI 4,1-28,4]. Nicht zu vernachlässigen war das Nebenwirkungsspektrum von Temsirolimus: Die häufigsten höhergradigen Toxizitäten waren die Erhöhung des Blutzuckers (29,7 %), Thrombozytopenien (21,6 %), Infektionen (19 %), Anämien (10,8 %) und Hautausschlag (8,1 %).
„Wir gehen davon aus, dass die Tumorzellen rasche Resistenzen gegen den Wirkstoff entwickelt haben, so dass die feststellbare Aktivität nicht von langer Dauer war“, interpretiert Korfel die Ergebnisse. „Zukünftig erscheint es uns deshalb sinnvoll, Temsirolimus in Kombination mit Zytostatika oder mit Rituximab und bereits in früheren Therapielinien einzusetzen“, umreißt die Ärztin Perspektiven für künftige Therapiestudien. „Vor dem Hintergrund der Toxizität des Wirkstoffs sollte dies vor allem jüngeren und fitten Patienten angeboten werden und mit einer prophylaktischen Antibiose einhergehen“, fügt sie hinzu.
Die Originalarbeit ist am 13.03.2016 unter dem Titel „Phase II trial of temsirolimus for relapsed/refractory primary central nervous system lymphome (PCNSL)“ im Journal of Clinical Oncology erschienen und kann unter folgendem Link abgerufen werden: http://jco.ascopubs.org/cgi/doi/10.1200/JCO.2015.64.9897
Quelle: Kompetenznetz Maligne Lymphome e.V. (KML)
Internet: www.lymphome.de
Kleinzelliger Lungenkrebs: Bestrahlung kombiniert mit Chemotherapie auch im hohen Alter effektiv
Lungenkrebs gehört in Deutschland zu den häufigsten bösartigen Erkrankungen, und bei Männern ist er die häufigste tödliche Krebsform. Es wird zwischen verschiedenen Formen des Lungenkrebses unterschieden. Beim kleinzelligen Bronchialkarzinom, einer Lungenkrebsvariante mit besonders schnellem Wachstum, kann die Kombination aus einer Strahlen- und Chemotherapie den Tumor am besten zurückdrängen. Neue Studienergebnisse zeigen, dass die Kombination auch bei Patienten jenseits des 70. Lebensjahres häufig vorteilhaft ist. Die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) rät wegen der mit der Behandlung verbundenen Risiken allerdings zu einer genauen Auswahl der Patienten.
Das kleinzellige Bronchialkarzinom, auf das etwa 15 Prozent aller Lungenkrebserkrankungen entfallen, wächst so rasch, dass eine Heilung durch eine Operation nur selten möglich ist. „Bei vielen Patienten wird der Tumor jedoch in einem Stadium entdeckt, in dem der Krebs die Lungengrenze noch nicht sichtbar überschritten hat“, sagt Professor Dr. med. , Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Universitätsklinikum Mannheim. In diesem sogenannten „limitierten“ Stadium sei die gleichzeitige Chemo- und Strahlentherapie die derzeit wirkungsvollste Therapie, fügt der DEGRO-Pressesprecher hinzu.
 Prof. Dr. Frederik Wenz,
Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Universitätsklinikum Mannheim sowie Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie e. V. (DEGRO)
Foto: Universitätsmedizin Mannheim
Prof. Dr. Frederik Wenz,
Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Universitätsklinikum Mannheim sowie Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie e. V. (DEGRO)
Foto: Universitätsmedizin Mannheim
Die Therapie wird älteren Patienten derzeit selten angeboten. Und dies, obwohl sie häufiger am kleinzelligen Bronchialkarzinom leiden als junge Patienten. „Es besteht die Sorge, dass die Patienten ab einem gewissen Alter die Belastungen durch Zytostatika und Strahlen nicht verkraften und vielleicht sogar an den Folgen der Therapie sterben“, sagt Professor Wenz.
Diese Bedenken scheinen in vielen Fällen unbegründet zu sein, wie die Auswertung eines amerikanischen Patientenregisters zeigt. Es umfasst mehr als 8600 Patienten mit kleinzelligem Bronchialkarzinom im limitierten Stadium, die auch nach dem 70. Lebensjahr noch eine kombinierte Radiochemotherapie erhalten hatten. Das erstaunliche Ergebnis: Während die Überlebenszeit von Patienten, die sich nur einer Chemotherapie unterzogen, auf neun Monate begrenzt war, überlebten Patienten, die eine Radiochemotherapie erhalten hatten, im Durchschnitt 15,6 Monate. Wenn Chemo- und thorakale Strahlentherapie gleichzeitig durchgeführt wurden, stieg die Überlebenszeit sogar auf 17 Monate. Nach einer kombinierten Radiochemotherapie waren 22 Prozent der Patienten noch nach drei Jahren am Leben, bei Verzicht auf eine Strahlentherapie waren es nur 6,3 Prozent.
„Die Studie zeigt, dass eine intensivierte Therapie mit simultaner Radiochemotherapie auch für ältere Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs vorteilhaft ist“, meint Professor Dr. med. Martin Stuschke, Direktor der Klinik für Strahlentherapie am Universitätsklinikum Essen. Die Angst, dass Patienten im fortgeschrittenen Alter die kombinierte Behandlung nicht mehr verkraften, sei häufig unbegründet, fügt der DEGRO-Experte hinzu. Er verweist auf Fortschritte in der Behandlung. „Nebenwirkungen der Zytostatika können heute besser behandelt werden, und die Dosisverteilungen können mit modernen Bestrahlungstechniken gezielter auf die thorakalen Tumore appliziert werden“, sagt der Experte aus Essen: „Auf Komplikationen können wir heute schneller und effektiver reagieren.“
Die kombinierte Radiochemotherapie könnte für die Mehrzahl der über 70-jährigen Patienten infrage kommen. In der US-Studie waren es 56 Prozent aller Patienten. „Die Behandlung ist jedoch nicht für alle Patienten geeignet“, schränkt Professor Wenz ein: „Bei mehreren Begleiterkrankungen, einem fortgeschrittenen Stadium und vor allem bei einem schlechten Allgemeinzustand raten wir von einer intensivierten Behandlung ab.“ In der letzten Lebensphase, in der sich die Patienten befinden, zähle nicht allein die Zahl der zusätzlichen Lebensmonate. Professor Wenz: „Unser Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität der Patienten.“
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie e. V. – DEGRO
Darmkrebs in der Familie? Früherkennung tut Not!
Obwohl Familienangehörige von Patienten mit Darmkrebs eine Hochrisikogruppe für die Entwicklung von Krebserkrankungen des Dickdarms und Enddarms sind, fallen sie im deutschen Gesundheitswesen noch zu oft durchs Raster. Anlässlich des Darmkrebsmonats rufen die niedergelassenen Krebsspezialisten dazu auf, Darmkrebspatienten und deren Familien konsequent über den enormen Nutzen der Krebsfrüherkennung bei Angehörigen von Darmkrebspatienten zu informieren, um so das Risiko zu verringern.

Der Darmkrebs ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen die zweithäufigste Krebserkrankung der inneren Organe. Im Laufe des Lebens erkrankt einer von 14 Männern und eine von 18 Frauen daran. “Wird die gesamte Lebensspanne betrachtet, beträgt das Risiko, einen Darmkrebs zu entwickeln, über alle Bevölkerungsgruppen hinweg etwa fünf Prozent (1)“, betont Dr. Michael Eckart aus Erlangen, Mitglied im Vorstand des Berufsverbands der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland – BNHO e.V..
Bei drei von zehn Patienten gab es schon Darmkrebs in der Familie
Doch nicht bei allen Menschen ist das Risiko gleich hoch. Alte Menschen erkranken häufiger an Darmkrebs als jüngere Menschen. Männer erkranken früher als Frauen. Besonders gefährdet sind Familienangehörige von Darmkrebspatienten, vor allem Eltern, Kinder und Geschwister. “Sie haben im Vergleich zu Menschen aus Familien ohne Darmkrebserkrankungen ein deutlich erhöhtes Risiko, selbst einen Darmkrebs zu entwickeln”, betont Eckart. In Deutschland finden sich bei knapp 30% aller Patienten mit Darmkrebs Familienangehörige, die ebenfalls an Darmkrebs erkrankt waren (2).Das heißt: Jeder dritte Darmkrebspatient hat statistisch gesehen einen nicht erkannten Darmkrebsfall in der eigenen Familie.
Verwandte ersten Grades haben doppelt so hohes Risiko
Wie hoch das Risiko der Familienangehörigen von Darmkrebspatienten ist, hängt davon ab, um welche Darmkrebsform es sich handelt und wie eng das Verwandtschaftsverhältnis ist. Bei der großen Mehrheit der so genannten sporadischen, also nicht direkt erblichen Darmkrebsformen ist das Risiko für Verwandte deutlich erhöht: “Wir gehen davon aus, dass das Risiko bei Verwandten ersten Grades von Darmkrebspatienten zwei- bis dreimal so hoch ist. Tritt der Darmkrebs vor dem 60. Lebensjahr auf, ist es sogar drei- bis vierfach erhöht (1)“, so Eckart.
Bewusstsein für familiäres Darmkrebsrisiko schärfen
Vor dem Hintergrund dieser Zahlen möchte der BNHO Darmkrebspatienten für das erhöhte familiäre Darmkrebsrisiko sensibilisieren und ihre Familienmitglieder zur frühzeitigen Vorsorge motivieren. Gleichzeitig appellieren die niedergelassenen Krebsspezialisten an alle Ärzte, die mit Darmkrebspatienten in Kontakt kommen, diese nicht nur allgemein darüber aufzuklären, dass Darmkrebs in Familien gehäuft auftreten kann. “Stattdessen muss aktiv nach Angehörigen gefragt werden, und alle Indexpatienten sollten Informationsmaterial für jeden näheren Angehörigen erhalten”, so der BNHO-Vorsitzende Prof. Dr. Stephan Schmitz.
Das Medizinsystem hat bisher für die systematische Einbeziehung der Verwandten keine Möglichkeiten geschaffen. Eine weitere wichtige Rahmenbedingung wäre die Vernetzung und Integration verschiedener ärztlicher Fachgruppen bei der Behandlung und Erkennung des familiären Risikos. Eine solche Zusammenarbeit würde nicht nur ermöglichen, frühzeitig Patienten mit Risiko zu identifizieren, sondern bereits Erkrankten eine qualitativ optimierte Versorgung zukommen zu lassen.
Quelle: Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland – BNHO e.V.
Gebärmutterhalskrebs – Früherkennug mit PAP-Abstrich oder HPV-Test?
Ab 2017 erhalten Frauen im Alter von 30 bis 60 Jahren eine persönliche Einladung zur neuen Gebärmutterhals-Früherkennung (Screening). Darin werden sie aufgefordert zu wählen, ob sie einmal im Jahr einen sogenannten PAP-Abstrich vom Gebärmutterhals oder alle fünf Jahre einen Test auf humane Papillomviren (HPVTest)
vornehmen lassen. Das Einladungsschreiben enthält auch Informationen über das Früherkennungsprogramm und die Untersuchungsmethoden. Die Bayerische Krebsgesellschaft e.V. bezweifelt aber, dass diese für Frauen ausreichend sind, um eine gute Entscheidung treffen zu können.
„Frauen müssen in Kürze zwischen PAP-Abstrich und HPV-Test wählen, ohne die Vor- und Nachteile beider Methoden ausreichend zu kennen und ohne die Möglichkeit, ihre Wahl in den nächsten fünf Jahren zu revidieren. Damit werden sie
ungewollt Teil eines großangelegten Experiments mit ungewissem Ausgang“, kritisiert Professor Marion Kiechle, Direktorin der Frauenklinik am Klinikum rechts der Isar der TU München. „Da es bisher keine wissenschaftlichen Studien gibt, die den HPV-Test als alleinige und sichere Untersuchungsmethode zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs bestätigen, rate ich allen Frauen bei dieser Entscheidung ihren Frauenarzt einzubeziehen und vorerst beim jährlichen PAP-Abstrich zu bleiben“; empfiehlt Marion Kiechle, Expertin für Frauenheilkunde.
Der PAP-Abstrich, benannt nach dem griechischen Arzt Dr. George Papanicolaou, ist Früherkennungsmethode Nr.1 in Deutschland. Regelmäßig angewendet findet er viele Zellveränderungen und kann so der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs entgegenwirken. So sank seit seiner Einführung im Jahr 1971 die Zahl der Neuerkrankungen und der Todesfälle um bis zu 75 Prozent. Heute macht Gebärmutterhalskrebs mit jährlich rund 4.600 Neuerkrankungen nur noch 2,1 Prozent aller bösartigen Krebsarten der Frau aus. „Der Erfolg wäre noch größer, würden alle Frauen ab 20 Jahre einmal im Jahr zur Krebsvorsorge gehen. Tatsächlich nahmen rund 60 Prozent der erkrankten Frauen in den letzten fünf
Jahren vor der Diagnose nicht an der Früherkennungsuntersuchung teil. Bleibt also zu klären, wie wir diese Frauen in Zukunft besser erreichen“, bestätigt Professor Günter Schlimok, Präsident der Bayerischen Krebsgesellschaft.
Der HPV-Test deckt Infektionen mit humanen Papillomviren (HPV) auf. Diese, vor allem die Risiko-Gruppen 16 und 18, können Gebärmutterhalskrebs auslösen, wenn die Infektion nicht ausheilt. Bei etwa 10 Prozent aller Frauen ist dies der Fall, bei ihnen kann es nach 10-15 Jahren zu Zellveränderungen am Gebärmutterhals kommen. Aber der HPV-Test erkennt keine Krebsvorstufen.Deshalb setzen Frauenärzte den HPV-Test heute vor allem bei Frauen ab 30 Jahren ein, umauffällige Befunde abzuklären und die Diagnose durch den PAP-Abstrich sinnvoll zu ergänzen. Bei positivem Testergebnis können weitere Untersuchungen dabei helfen, mögliche Krebsvorstufen frühzeitig zu entdecken. „Deshalb empfehlen wir für Frauen ab 30 Jahren eine Kombination aus PAP-und HPV-Test. Sie bietet derzeit den besten Schutz und verringert auch das Risisko falsch-positiver oder falsch-negativer Testergebnisse, die wir zum heutigen Zeitpunkt bei beiden Untersuchungsmethoden noch nicht völlig ausschließen können“, so Kiechle.
Für Frauen zwischen 20 und 30 Jahren ändert sich vorerst nichts, da bei ihnen HPVInfektionen häufiger sind, aber auch oft von selbst ausheilen. Deshalb wird für diese Altersgruppe auch kein routinemäßiger HPV-Test empfohlen.
Quelle: Bayrische Krebsgeselllschaft e.V.
Schmerztherapie – Neuer Wirkstoff Oxytocin doppelt wirksam gegen Schmerz
Wissenschaftler aus der Schaller-Forschungsgruppe “Neuropeptide” (Deutsches Krebsforschungszentrum, CellNetworks und ZI Mannheim) identifizierten im Gehirn ein “Schmerz-Kontrollzentrum”. Dort kooperieren zwei verschiedene Typen Oxytocin-produzierender Nervenzellen und unterdrücken so den Schmerz gleich doppelt: Oxytocin blockiert die Weiterleitung von Schmerzreizen im Rückenmark und hemmt gleichzeitig die Schmerzempfindung in der Körperperipherie.
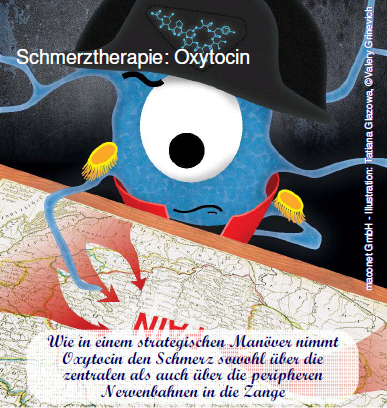
“Kuschelhormon” und Neurotransmitter: Das Neuropetid Oxytocin kann beide Rollen spielen: Als Hormon wirkt es im Körper und löst etwa Wehen aus oder leitet den Milchfluss ein. Im Gehirn wirkt Oxytocin als Botenstoff zwischen Nervenzellen, dämpft Ängste und beeinflusst das menschliche Sozialverhalten positiv. Seit kurzem vermuten Wissenschaftler auch, dass es als körpereigene Schmerzbremse wirkt.
Im Hypothalamus, dem wichtigstem Steuerzentrum des vegetativen Nervensystems, produzieren zwei verschiedene Arten von Nervenzellen Oxytocin. Die sogenannten großzelligen (“magnozellulären”) Oxytocin-Neuronen speisen das Neuropeptid über die Hirnanhangdrüse in die Blutbahn ein und versorgen so den Körper mit dem Hormon. Die Aufgabe der kleinzelligen (“parvozellulären”) Oxytocin-Neuronen war noch nicht genau verstanden.
Wissenschaftler um Valery Grinevich entdeckten nun an Ratten einen Bereich im Hypothalamus, der als Schmerz-Kontrollzentrum funktioniert. Nur etwa 30 parvozelluläre Oxytocin-produzierenden Nervenzellen orchestrieren dort die schmerzhemmende Wirkung des Neuropeptids. Grinevich leitet die Schaller Forschungsgruppe “Neuropeptide”, die am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), am Exzellenzcluster CellNetworks der Universität Heidelberg und am ZI Mannheim angesiedelt ist. Er koordinierte das internationale Forschungsprojekt gemeinsam mit Kollegen aus Frankreich und der Schweiz.
Die kleine Gruppe der neu entdeckten Neuronen treten bei akuten Schmerzen oder Entzündungen in Aktion: Unter diesen Bedingungen aktivieren sie die magnozellulären Oxytocin-produzierenden Neuronen im benachbarten “supraoptischen Nukleus” des Hypothalamus. Das löst die die Oxytocin-Ausschüttung in die Blutbahnen aus und lindert dadurch diffus die Schmerzempfindung, die über entsprechende periphere Nervenzellen vermittelt wird.
Auf der anderen Seite reichen die Neuronen des Schmerz-Kontrollzentrums mit langen Ausläufern bis in tiefe Schichten des Rückenmarks. Dort speisen sie das Neuropeptid exakt an der Stelle des Zentralnervensystems ein, wo die Intensität der Schmerzwahrnehmung weitergeleitet wird.
Die neu entdeckten Neuronen hemmen den Schmerz also auf doppelte Weise: Ein schneller schmerstillender Effekt entsteht durch Filtern des Schmerzreizes im Zentralnervensystem. Etwas länger dauert es, bis das ins Blut ausgeschüttete Oxytocin die Schmerzempfindung lindert.
“Wir haben hier erstmals gezeigt, dass zwei anatomisch unterschiedliche Neuronentypen funktionell kooperieren müssen, um die Oxytocin-Wirkung zu steuern, sagt der Valery Grinevich. Oxytocin wird wegen seiner positiven Wirkung auf das Sozialverhalten bereits seit längerem als Medikament gegen bestimmte Symptome von Autismus oder Schizophrenie diskutiert. “Von jetzt an sollten wir auch darüber nachdenken, wie sich Oxytocin als Schmerzstiller therapeutisch einsetzten lässt”, kommentiert Grinevich seine aktuellen Ergebnisse.
Quelle: Deutschen Krebsforschungszentrums, des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit und des Exzellenzclusters CellNetworks
Literaturhinweis:
Marina Eliava, Meggane Melchior, H. Sophie Knobloch-Bollmann, Jérôme Wahis, Miriam da Silva Gouveia, Yan Tang, Alexandru Cristian Ciobanu, Rodrigo Triana del Rio, Lena C. Roth, Ferdinand Althammer, Virginie Chavant, Yannick Goumon, Tim Gruber, Nathalie Petit-Demoulière, Marta Busnelli, Bice Chini, Linette L. Tan, Mariela Mitre, Robert C. Froemke, Moses V. Chao, Günter Giese, Rolf Sprengel, Rohini Kuner, Pierrick Poisbeau, Peter H. Seeburg, Ron Stoop, Alexandre Charlet, and Valery Grinevich: A new population of parvocellular oxytocin neurons controlling magnocellular neuron activity and inflammatory pain processing. NEURON 2016, DOI: 10.1016/j.neuron.2016.01.041